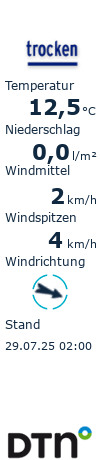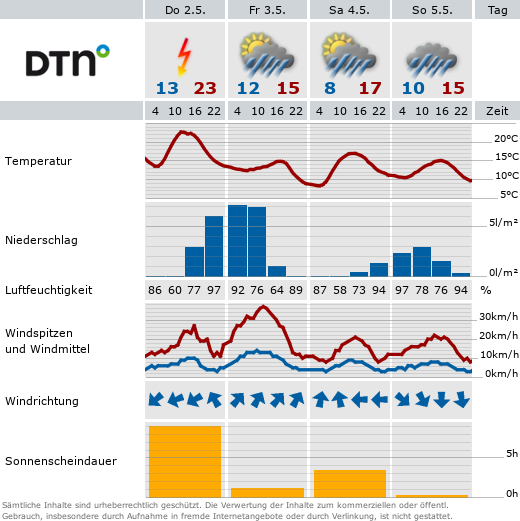Das arbeitsteilige System deutscher Metropolregionen - Erfassung und Analyse metropolitaner Funktionen im deutschen Städtesystem
Projektlaufzeit: März 2009 bis März 2012
Durch das Raumordungskonzept der Metropolregionen hat die Rolle der großen Städte für die Raumentwicklung eine besondere Beachtung erfahren. Allerdings beruht das Raumordnungskonzept auf wenig befriedigenden und teilweise lückenhaften Kenntnissen über die Struktur und Dynamik des metropolitanen Systems in Deutschland. Mit dem kürzlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bewilligten dreijährigen Forschungsprojekt sollen die analytischen Grundlagen für das Raumordnungskonzept der Metropolregionen vertieft werden.
Zum einen zielt das Projekt auf eine theoretisch fundierte Systematisierung metropolitaner Funktionen und auf eine empirische Erfassung der funktionalen Struktur des Systems der deutschen Metropolregionen, auch im zeitlichen Verlauf des letzten Jahrzehnts. Auf der Grundlage eines empirischen Messkonzepts wird untersucht, inwiefern das deutsche Städtesystem hierarchisch aufgebaut ist bzw. inwiefern es durch sektorale Funktionsspezialisierungen charakterisiert wird. Gefragt wird nach Prozessen der Polarisierung bzw. Hierarchisierung und den dahinter stehenden Determinanten. Zu prüfen ist auch die Hypothese einer Zunahme sektoraler Funktionsspezialisierungen, die vor allem im Kontext globaler Verflechtungen vermutet werden.
Zum zweiten sollen die Knotenfunktionen von metropolitanen Städten und ihre räumlichen Verflechtungsmuster empirisch erfasst und modelliert werden. Als Indikator dienen u.a. Mehrbetriebsunternehmen, welche durch ihre betrieblichen Standortsysteme zur Ausbildung sektoraler Verflechtungsstrukturen beitragen. Zur Erklärung der aufgezeigten räumlichen Muster werden Theorien unterschiedlicher Provenienz herangezogen.
Schließlich soll die Dynamik der intraregionalen Raumstruktur von Metropolräumen analysiert werden. Neben einer Beschreibung der räumlichen Struktur- und Verflechtungsmuster geht es um die Frage, wie sich die unterschiedlichen Raumstrukturtypen (mono- und polyzentrisch strukturierte Metropolräume) im Zeitverlauf entwickeln und ob die Hypothese einer raumstrukturellen Konvergenz der unterschiedlichen Typen bestätigt werden kann.
Harrison, J.; Growe, A. 2012: From Places to Flows? Planning for the New ‘Regional World’ in Germany. In: European Urban and Regional Studies. (http://eur.sagepub.com/content/early/2012/04/20/0969776412441191)
Growe, A. 2012: Knoten in Netzwerken wissensintensiver Dienstleistungen. Eine empirische Analyse des polyzentralen deutschen Städtesystems. Verlag Dorothea Rohn, Detmold.
Harrison, J. and Growe, A. (2011): From places to flows? Planning for the new 'regional world' in Germany. In: Beauclair, A. and Mitchell, E. (Ed.): Contested Regions: Territorial Politics and Policy. Regional Studies Association. Seaford. pp. 41-44.
Growe, A. (2011): Die Gatewayfunktion – Von Verkehrsinfrastruktur zu Knoten im Netz? In: Hege, H.-P.; Knapstein, Y.; Meng, R.; Ruppenthal, K.; Schmitz-Veltin, A.; Zakrzewski, P. (Hg.): Schneller, öfter, weiter? - Perspektiven der Raumentwicklung in der Mobilitätsgesellschaft. Arbeitsberichte der ARL 1. Hannover, pp. 44-55. (http://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/ab/ab_001/ab_001_06.pdf?frontend=a1f5af7b256d39ea1b90650ea04b2a99)
Growe, A.; Blotevogel H. H. (2011): Knowledge hubs in the German urban system: Identifying hubs by combining networking and territorial perspectives. In: Raumforschung und Raumordnung, Vol. 69, 3, pp. 175-185.
Blotevogel, H. H. 2010: Raumordnung und Metropolregionen. In: Geographische Rundschau 11/2010, pp. 4-12.
Growe, A. 2010: Human capital in the German urban-system - patterns of concentration and specialization. In: European Journal of Spatial Development, refereed article no. 40.
Growe, A; Münter, A. 2010: Die Renaissance der großen Städte. In: Geographische Rundschau 11/2010, pp. 54-59.
Growe, A. 2009: Wissensträger und Wissensvernetzung in Metropolregionen. In: Raumforschung und Raumordnung 5/6.2009, pp. 383-394.
Growe, A. 2009: Concentration of knowledge-based professions in the German city-system. In: Schrenk, M.; Popovich, V.; Engelke, D.; Elisei, P. (Eds.): REAL CORP 2009: CITIES 3.0 - Smart, Sustainable, Integrative. Strategies, concepts and technologies for planning the urban future, pp. 59-72.
Blotevogel, H. H.; Schulze, K. 2009: Zum Problem der Quantifizierung der Metropolfunktionen deutscher Metropolregionen. In: Knieling, J. (Eds.): Metropolregionen - Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit. Hannover, ARL, pp. 30-58.
- Growe, A.: Die Gatewayfunktion – Von Verkehrsinfrastruktur zu Knoten im Netz?
- Harrison, J.; Growe, A.: From Places to Flows?
- Rüdiger, Andrea; Riedel, Natalie: Umwelt- und Gesundheitsbezogene Chancengleichheit durch räumliche Planung in der Stadt.
- Growe, A.: Knoten in Netzwerken wissensintensiver Dienstleistungen.
- Harrison, J.; Growe, A. : From Places to Flows? Planning for the New ‘Regional World’ in Germany.